Die Bodenschutzkalkung wird nach wie vor als Mittel gegen Bodenversauerung propagiert. Doch dieses Verfahren bringt mehr Schaden als Nutzen – und das ist schon lange bekannt.
Was ist eine Waldkalkung?
Wird Waldboden zu sauer, zerstört das Bodenstrukturen teilweise unwiderruflich und Bäume können absterben. Kalk soll die Säure neutralisieren. Bei der Wald- bzw. Bodenschutzkalkung wird kohlensaurer Magnesiumkalk, meist per Hubschrauber, großflächig über Wäldern ausgebracht.
Warum kalkt man Wald?
In den 1980er-Jahren waren die Folgen des sauren Regens u.a. durch industrielle Emissionen und Autoabgase dramatisch. Die Einführung von Katalysatoren bei Fahrzeugen und die Rauchgasentschwefelung in Fabriken haben die Belastung seitdem stark reduziert. Dennoch ist die Waldkalkung auch heute noch Thema in der Forstwirtschaft und wird sogar gefördert.
Die Nachteile der Waldkalkung
Durch die Ausbringung von kohlensaurem Magnesiumkalk wird der pH-Wert des Bodens erhöht. Das aktiviert Bakterien und Pilze, die den wertvollen Humus – die organische Substanz des Bodens – schneller abbauen. Kurzfristig führt dies zu einem Wachstumsschub, da viele Nährstoffe freigesetzt werden. Doch langfristig wird der Boden verarmen, da der Humus als zentrale Wasser- und Nährstoffquelle verloren geht. Gleichzeitig wird Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, was den Klimawandel weiter befördert.
Ein altes Sprichwort aus der Landwirtschaft bringt es auf den Punkt: „Kalk macht reiche Väter und arme Söhne.“ Der kurzfristige Nutzen wird teuer erkauft und hinterlässt langfristige Schäden – auch im Wald.
Naturwälder vs. Waldkalkung
Zu den oben genannten Problemen kommt ein weiteres hinzu: Einige natürliche Waldböden sind von Natur aus sauer, und die Pflanzen sind darauf spezialisiert. Werden diese Böden gekalkt, verschwinden auch die spezialisierten Pflanzenarten.
Die Natur hat jedoch eigene Mechanismen zur Regeneration: Beispielsweise kann die Vogelbeere Kalk aus tieferen Bodenschichten an die Oberfläche bringen. Durch den Laubfall gelangen diese Mineralstoffe später zurück in den Kreislauf.
Klar ist auch: Will man keinen sauren Waldboden, sollte man auf Monokulturen wie Fichten- und Kiefernplantagen verzichten. Diese Nadelbäume tragen durch ihre sauren Nadeln zur Versauerung des Bodens bei und hinterlassen teils schwer abbaubare Streuteppiche.
Der Wechsel hin zu natürlicheren Wäldern ist also auch wenn wir über die Versauerung der Böden sprechen – wie so oft – eine sinnvolle, ökologische Lösung.
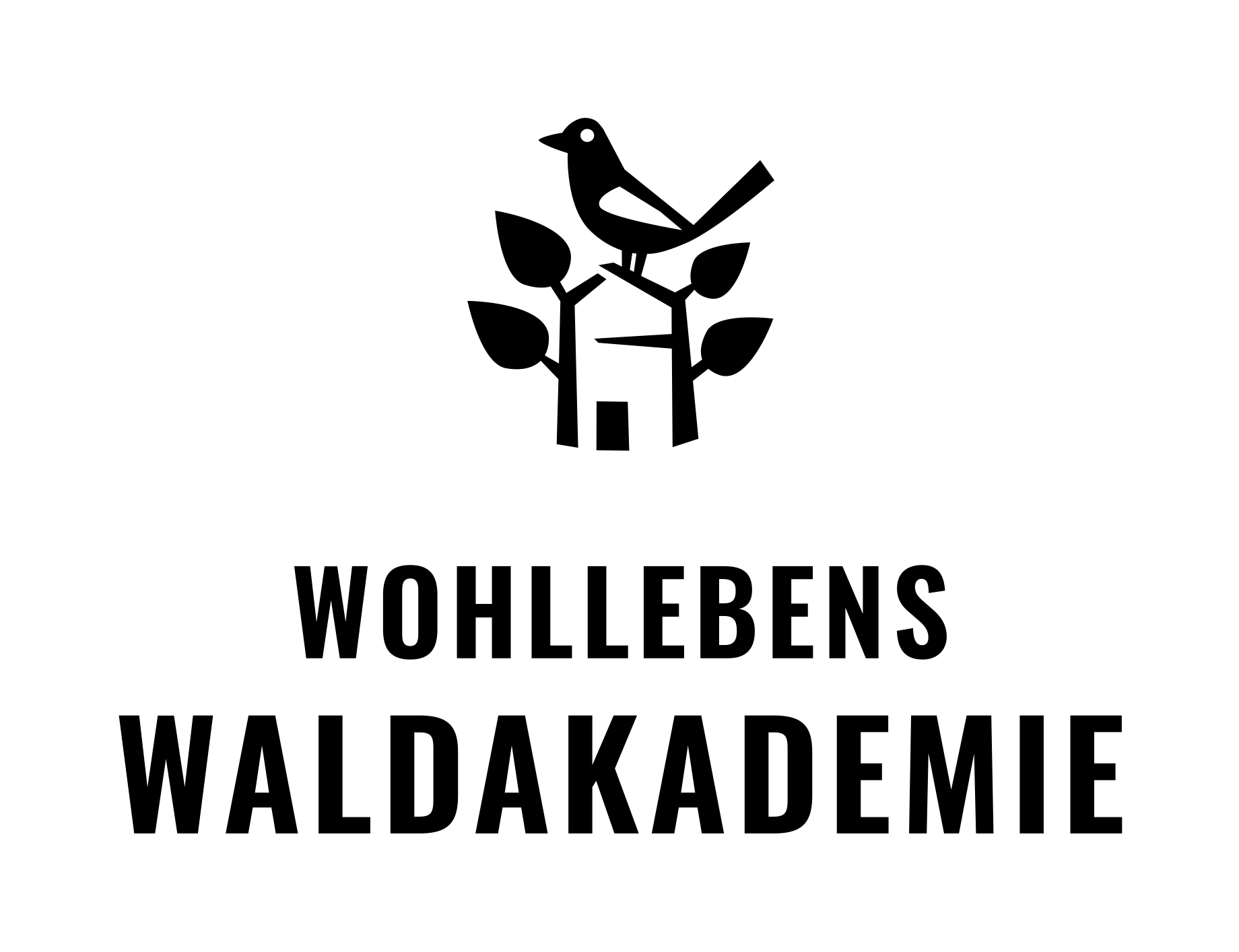
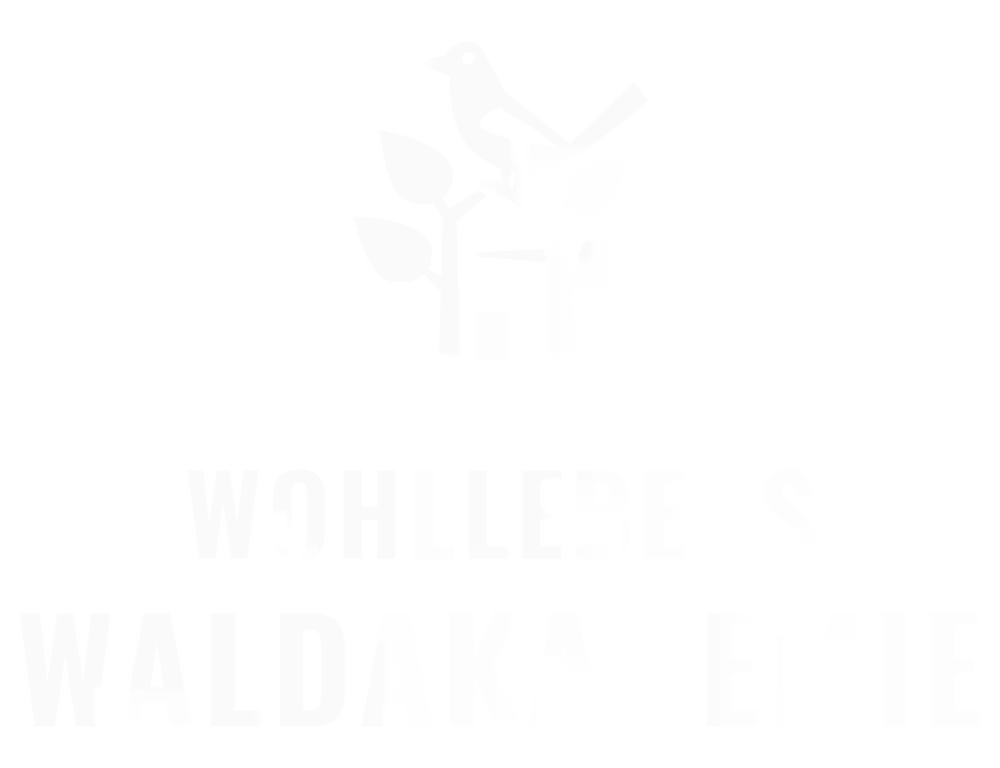




Hinterlasse einen Kommentar
Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.